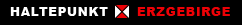
Auch in Oma Lieselottes Garten herrschte an diesem schwülen Sommerabend reges Treiben. Wie alle Jahre wurde Großmutters Geburtstag durch die weitläufige Verwandtschaft feierlich begangen, und da es sich diesmal um ihren fünfundachzigsten handelte, war der Trubel besonders groß. Von nah und fern war man zum Schmause herbeigeeilt, und selbst die etwas popelige Westverwandtschaft hatte es sich diesmal nicht nehmen lassen, der Jubilarin ihre Referenz zu erweisen. Auch Pfarrer Gottlieb Selig und Bürgermeister Wolfgang Kunze waren auf eine Wurst und ein Bier vorbeigekommen, um etwas später am Abend das Engagement der rüstigen Dame für die Gemeinde mit ein paar anerkennenden Worten geziemend zu würdigen. Dazu spielte der Posaunenchor Choräle und Polkas, wenn nicht gerade Enricos Schwager Herbert als Hobby-DiscJockey heimatliche Klänge aus dem Schwarzwald, dem Riesengebirge und dem austro-bajuwarischen Alpenlande vom Band in hitverdächtiger Lautstärke erdröhnen ließ. Einige Mädchen aus der Nachbarschaft, die zuvor heimlich am Wein genippt hatten, fingen bereits an zu tanzen, und Rolf, Enricos Intimfreund, der diesmal auch mitgekommen war, tollte im Garten mit den Kindern, von denen er bereits mit „Onkel“ tituliert wurde. Enrico, der am festlich geschmückten Tisch in fröhlicher Runde beim Bier saß, ließ seine Augen müde zu ihnen hinüberschweifen. Er beobachtete zerstreut, wie sich Rolf in der Rolle des Tormanns verzweifelt bemühte, die geschickt gedrippelten Bälle seines Sohnes René, der seit kurzem in der Schulmannschaft zum Stürmer aufgestiegen war, zu erhaschen. Das gelang ihm jedoch nur selten. Trotzdem stachelte er den Jungen mit einem leicht spitzbübisch zwinkerndem Lächeln immer wieder zu immer gewagteren Angriffen an, mit einem Lächeln, wie es sein Sohn René gewöhnlich aufsetzte, wenn er seine drei Jahre ältere Schwester Sandra necken wollte. Diese frappante Ähnlichkeit fiel Enrico heute zum ersten Male auf. Bald glaubte er, auch gewisse weitere Ähnlichkeiten zwischen den beiden zu erkennen: die braunen, warm schillernden Mandelaugen, das gelockte dunkelblonde Haar, das kleine, etwas spitz auslaufende Kinn, das alles konnte einen auf ziemlich dumme Gedanken bringen, wenn man nicht genau gewußt hätte ...
Er vermied es, seine verfänglichen Gedanken weiter zu spinnen, und wendete sich abrupt seinem Schwager Willy zu, der schon seit einer Weile erfolglos versucht hatte, ihm zuzuprosten und in ein Gespräch über seine alles geliebte Feuerwehr, von der ebenfalls einige trink- und sangesfreudige Kameraden zum Feste erschienen waren, zu verwickeln.
„Und weißt du, was unser schwerster Einsatz in den Jahren nach der Wende war?“, fragte Willy gerade, mit großen Kulleraugen Aufmerksamkeit heischend in die aufgeschreckte Tischrunde blickend.
Für einen Augenblick wurde alles ruhig am Tisch, denn Willys sich bisweilen überschlagende Fistelstimme hatte den unangenehmen Nebeneffekt, sich auf penetrante Weise auch beim größten Lärm durchsetzen zu können, eine Fähigkeit, die bei seinen gelegentlichen Einsätzen als Oberlöschmeister der Dorffeuerwehr von größtem Nutzen sein mochte, im bürgerlichen Leben aber gewöhnlich nur als störend empfunden wurde.
„Nun, das war doch sicherlich euer Großeinsatz beim Löschen des Franzosenhäusels im Niederdorf“, hörte man da Herbert von seiner Beschallungsanlage her höhnend herüberrufen.
„Ihr kamt zwar ziemlich spät zum Löschen, aber zum Glück immer noch früh genug, um unsere Gemeinde endlich von diesem hartnäckigen Verkehrshindernis zu befreien.“
Über dieses böswillige, sich aber trotzdem hartnäckig haltende Gerücht im Dorf, das Herbert bereits zum wiederholten Male seinem Schwager in aller Öffentlichkeit vorhielt, konnte Willy überhaupt nicht lachen. Schließlich ging es hier um die Ehre seiner Feuerwehr, und da war bei ihm strikter Korpsgeist angesagt. Auch Bürgermeister Kunze guckte auf einmal ziemlich verunsichert drein, denn ihm wurde dem gemeinen Gerücht zufolge die Rolle des Auftraggebers bei der vermeintliche Brandstiftung zugeschrieben.
Als daher Willy von jäher Wut gepackt seinem verachteten Nazischwager ein paar deutliche Worte in puncto „Dorfehre“ und „Heimattreue“ zubrüllen wollte, tippte ihm der Bürgermeister beruhigend auf die Schulter.
„Komm laß mal, Willy“, ließ er sich mit seiner angenehmer Baritonstimme vernehmen. „Erzähl uns doch lieber, ob du vorhin nicht auf euren schwierigen Einsatz beim Großbrand in der Mastviehanlage Anno 92 angespielt hast.“
Doch Willy ließ sich nicht so schnell beruhigen, und ein wenig stotternd, wie fast immer, wenn er über die Maßen erregt wurde, bellte er über den Tisch zu seinem verhassten Schwager zurück:
„D-d-d-d-d-as könnte dir so passen, Lump. Ich frage dich doch auch nicht, wo du neulich nachts warst, als beim Asylantenheim d-d-der Heuschober gebrannt hat!“
„Das hat nun aber gar nichts mehr mit der Sache zu tun, Willy“, mischte sich jetzt Bürgermeister Kunze, nun bereits eine kleine Nuance nachdrücklicher, in den allmählich eskalierenden Streit zwischen den beiden dorfbekannten notorischen Kampfhähnen ein, sein inzwischen hochrot angelaufenes Gesicht dem feuchten Sprachschwall Willys mutig die Stirn bietend. Die jähe Färbung seines Gesichtes hatte allerdings nicht im entferntesten etwas mit gemütsbedingter Aufwallung zu tun, denn Kunze war für seine beinahe als stoisch zu bezeichnende Ruhe weit über die Grenzen seines Heimatdorfes hinaus berühmt, einer Ruhe, die ihn in dieser Zeit krisenbedingten permanenten Politikermangels fast den Posten des CDU-Kreisparteichefs beschert hätte, wäre da nicht vor Jahren einmal ein kleiner Skandal gewesen, in den er randläufig verwickelt gewesen war. Nein, seine auffällige Gesichtsverfärbung hatte wohl viel eher mit der Tatsache zu tun, daß aus der Wurst und der Flasche Bier, die er eingangs zu verzehren versprochen hatte, inzwischen drei saftige große Steaks, vier dicke Rostbratwürste und ein halbes Dutzend Halblitergläser Faßbier geworden waren, also Grund genug, um ausnahmsweise einmal Farbe zu bekennen.
Nichtsdestotrotz zeigte Kunzens Beschwichtigungsaktion positive Wirkung. Oberlöschmeister Willy, der auf einmal ziemlich kleinlaut geworden war, reichte seinem Dorfoberhaupt, sich vielmals für den Zwischenfall entschuldigend, eine Serviette, während Herbert, „das Städtchen Kufstein“ in betäubender Lautstärke den Gästen zu Gehör brachte, dadurch unbeabsichtigt auch die sich gerade für ein neues Ständchen am Gartentor sammelnden Bläser zu einer weiteren Bierpause nötigend. Als sich Enrico nach einer Weile schließlich bei Willy erkundigen wollte, über welche schlimme Brandkatastrophe er denn vorhin eigentlich hatte plaudern wollen, winkte dieser nur ungeduldig ab: er habe jetzt keine Zeit zum Debattieren, er solle ihn doch lieber vorbeilassen, denn seine Blase drücke ihm gewaltig.
Auch unter den versammelten Frauen hatte sich inzwischen eine angeregte feucht-fröhliche Stimmung breit gemacht. Oma Lieselotte ließ es sich dennoch nicht nehmen, den Damen immer wieder süße Liköre einzuschenken, die nach der genossenen Bowle und dem Wein am Nachmittag ein immer ausgelasseneres Benehmen an den Tag legten. Besonders Gerda krähte von Zeit zu Zeit lauthals über irgendwelche losen Witze, die die Runde machten. Enrico war der beschwipste Zustand seiner Gattin gar nicht recht, befürchtete er doch, daß zu Hause, wie gewöhnlich nach solchen Festivitäten, Übelkeit und schlechte Laune folgen würden, die mitunter ein bis zwei Tage anhalten konnten. Um das exzessive Trinkverhalten seine Frau etwas zu bremsen, näherte er sich vorsichtig von der Seite her der Damenrunde, sein Bierglas vorsichtshalber am Herrentisch zurücklassend.
Enricos gute Absicht wurde jedoch von Gerda als böswilliger Angriff und unrechtmäßige Einmischung in ihre Privatsphäre fehlinterpretiert. Wie von einer Tarantel gestochen, fing sie daher sogleich an zu kreischen, nachdem ihr Enrico ein paar gut gemeinte Worte ins Ohr geflüstert hatte. Ihre Freundinnen und Verwandten machten große Augen und versuchten, den sich anbahnenden hysterischen Anfall mit ein paar versöhnlichen Worten zu dämpfen. Doch ohne jeglichen Erfolg. Im Gegenteil, Gerda schien durch ihre Beschwichtigungen gerade erst richtig Feuer zu fangen, wie ein gefährlich vor sich hin schwelender Brandherd, der durch das unvorsichtige Öffnen eines Fensters plötzlich ausreichend Sauerstoff erhält, um sich zu einem flammenden Inferno zu entwickeln, das alles verschlingt, was sich ihm in den Weg stellt. Ihre ganze angestaute Wut, die nun endlich einen Weg aus ihrem Inneren nach draußen gefunden hatte, richtete sie geballt gegen ihren nun wie gelähmt neben ihr stehenden Ehemann, der, einem unvorsichtigen Löschtruppführer gleich, von den jäh heranschießenden Flammen überrumpelt wurde, die er doch eigentlich hatte ersticken wollen.
Gerda, die ansonsten nie ein Sterbenswörtchen über ihre familieninternen Probleme in die Öffentlichkeit dringen ließ, denn auf ihre Busenfreundin Heidi konnte sie sich hundertprozentig verlassen, ließ nun endgültig alle Hemmungen fallen. Wutentbrannt beschimpfte sie Enrico vor versammelter Runde als „erbärmlichen Schlappschwanz“ und „Sozialschmarotzer“, der sich seit Jahren erfolgreich vor jeder Arbeit drücke, den ganzen Tag nur faul zu Hause herumsäße, um schlechte Laune zu verbreiten, und der auf diese Weise Frau und Kinder ganz sicher noch an den Bettelstab bringen werde. Enrico hätte sich in diesem Moment am liebsten in die finsterste Ecke des Gartens verkrochen, doch seine Schmach sollte noch lange nicht ihren Höhepunkt erreicht haben. Denn jetzt holte Gerda zum Vernichtungsschlag gegen ihren einst so geliebten, in den letzten Jahren immer mehr an Achtung verlierenden und seit kurzem nur noch als Belastung und Bedrohung empfundenen Gemahl aus.
„Daß du ein schlimmer Säufer bist, das wissen ja inzwischen alle. Aber das, was ich heute über dich erfahren mußte, setzt dem allen noch die Krone auf, du Schuft und Verbrecher!“
In großer Hektik begann sie nun in ihrer Handtasche zu wühlen, bis sie ein zerknülltes Kuvert zu fassen bekam, das sie flugs herausholte und öffnete. Zum Vorschein kam ein an Enrico Walther adressiertes Schreiben, das sie nun hastig entfaltete, um es dann für eine ganze Weile wie eine erbeutete Kriegstrophäe vor den Augen der erstaunt aufblickenden versammelten Gemeinde wie besessen über ihrem Kopf in der Luft herumzuwirbeln. Durch diesen taktisch klug inszenierten Derwischsakt gelang es ihr, die Aufmerksamkeit auch des letzten stillen Zechers vor Ort zu erringen. Mit zitternder Hand ging sie nun daran, ihre Lesebrille hervorzusuchen, um den Text des Schreibens dem immer verblüffter dreinschauenden Publikum mit erregter Stimme zu verlesen. Von Zeit zu Zeit legte sie dabei kurze rhetorische Pausen ein, um absolut sicher zu gehen, daß auch alle die Schwere des belastenden Inhalts vollkommen erfaßten, aber auch, um eigene bitter-böse Kommentare als Pointen einzustreuen.
„Sehr geehrter Herr Walther,“ hub sie also an, räusperte sich dann vernehmlich und bemerkte dazu verächtlich: „Damit ist mein lieber Ehegatte gemeint, falls das einer von euch noch nicht begriffen haben sollte! Doch weiter im Text: 'In der Strafsache Ladendiebstahl am 1. April 200x in der Dietl-Verkaufsstelle in xxx. Wir möchten Ihnen hiermit mitteilen, dass die Geschäftsleitung der Dietl-Filiale bereits am 4. April 200x beim zuständigen Amtsgericht in xxx eine Anzeige wegen versuchten Ladendiebstahls eines Päckchens Bohnenkaffe Marke Jakobs die Krönung gegen sie erhoben hat. Das Verfahren gegen Sie wird am Montag, den 10. September, 9 Uhr, eröffnet werden. Es wird darauf hingewiesen, dass eine rechtliche Vertretung von Ihrer Seite geboten ist. ...“
Während Gerda in einem immer höhnischer werdenden Tonfall das Schreiben des Amtsgerichts bis zum abschließenden „Hochachtungsvoll“ der zeichnenden Richterin herunterrasselte, war Enrico, der reglos neben ihr stehengeblieben war, immer blasser geworden. Als die Rezitatorin schließlich in ihrem Wortschwall innehielt, herrschte einen Moment lang betretenes Schweigen. Selbst die noch anwesenden Kinder hatten mit Spielen aufgehört, um das ungewöhnliche Verhalten der Erwachsenen argwöhnisch zu beäugen. Enrico begriff plötzlich, daß durch die schonungslose Enthüllung seiner Gattin sein guter Ruf im gesamten Dorf, wo ihn ein jeder kannte, auf Dauer ruiniert worden war. Er schaute zitternd vor Erregung zu Boden, um nicht in die erstaunten, verächtlichen oder sogar zynisch grinsenden Gesichter seiner lieben Verwandten und Bekannten blicken zu müssen. Trotzdem spürte er ganz deutlich, daß ein halbes hundert Augenpaare vorwurfsvoll auf ihn gerichtet war. Eine jähe Wut überfiel ihn, und ehe es sich Gerda versah, hatte er ihr eine kräftige Ohrfeige verpaßt und den Brief, den sie noch immer fest umklammert hielt, ihren Händen entrissen. Gerda taumelte zurück, den Kopf schützend vor ihr Gesicht haltend, doch ohne einen Laut des Schmerzes von sich zu geben. Enrico beachtete sie nicht weiter, sondern stürzte sich ohne nach links und rechts zu blicken blindlings durch die Menge, um einen Augenblick später hinter der Gartenpforte im Dunkel der Nacht auf Nimmerwiedersehen zu entschwinden.
Erst jetzt erholten sich die Gäste allmählich von dem so aufregenden Schauspiel, das sich ihnen geboten hatte. Doch mit Rücksicht auf Gerda, die von ihrer Freundin Heidi tröstend in die Arme genommen worden war und nun stille Tränen vergoß, getraute man sich nur im Flüsterton über das Geschehene zu äußern. Nur Vater Walther, der schon seit vielen Jahren seinen einzigen Sohn für einen jämmerlichen Versager und Waschlappen hielt und deshalb die familiären Beziehungen zu ihm auf ein Mindestmaß reduziert hatte, fing mit einem Mal vernehmlich an zu schimpfen, faßte seine Frau am Arm und sagte zu ihr verärgert:
„Komm schon Erna, wir müssen endlich nach Hause, Hasen füttern. Wir haben hier schon viel zu lange rumgetrödelt“.
Erna folgte ihm, ohne einen Mucks zu wagen, wie sie es schon all die Jahre während ihrer nun schon bald fünfzig Jahre währenden Ehe gepflogen hatte.
Während Willy kopfschüttelnd zu Herbert hinüberging, um ihn darum zu bitten, die verdorbene Stimmung durch ein paar aufmunternde Klänge aus der Konserve wieder aufzulockern, versuchte Rolf den verblüfften Kindern mit sorgfältig gewählten Worten die Affäre als „belanglosen Ausrutscher von Onkel Enrico“ darzustellen. Doch ehe er mit seiner Erklärung zu einem Ende gekommen war, donnerte ein zünftiges „Wir san die lustigen Holzhackerbuam“ durch den Garten. Aber keiner der sangesfreudigen Gäste sang diesmal mit, kein ausgelassenes Mädchen traute sich nunmehr, das Tanzbein zu schwingen, und auch Oma Lieselotte hatte aufgehört, die immer noch zahlreich versammelte Gästeschar weiter zu bewirten. Sie hatte sich schweigend in eine stille Ecke zurückgezogen. Dort saß sie händeringend und machte sich die größten Sorgen um ihren lieben Enkel Enrico, dem ausgerechnet zu ihrem Geburtstag so übel mitgespielt worden war. Sie war die einzige, die in dieser Nacht aufrichtig um den Jungen trauerte und sich vornahm, ihm so bald wie möglich ein paar tröstende Worte zu sagen und ihre Hilfe bei dem zu erwartenden ernsten Familienkrach anzubieten. Warum nur hatte ihr der Junge nichts von seinen Geldsorgen erzählt? Sie hätte ihm doch von Herzen gerne hilfreich unter die Arme gegriffen.
Es dauerte nicht mehr lange bis zum allgemeinen Aufbruch der Geburtstagsbesucher, die sich zum Abschied alle nochmals verlegen die Hände reichten. Gerda stieg mit Sandra und René in Rolfs Wagen, um sich von ihm nach Hause fahren zu lassen. Nur Willy hielt seine Stellung in der Nähe des Einhundertliter-Bierfasses und schaute ziemlich deprimiert drein, denn als ehrenamtlicher Bierwart tat es ihm unsäglich leid, so viele Liter unverbrauchten Hopfensaftes bei Oma Lieselotte zurücklassen zu müssen. Das konnte er der guten alten Dame beim besten Willen nicht antun! So saß er noch bis gegen früh am Zapfhahn, unterstützt von Herbert, der auf seine Discoanlage aufpassen mußte und im Auftrage der Großmutter für einen geordneten Abschluß der Feier sorgen sollte. Erst gegen Morgen wankten die beiden eng umschlungen und die „Internationale“ intonierend ins Gästezimmer, wo ihnen Lieselotte ein Bett für die Nacht bereitet hatte.
Aus: Stefan Mösch: Enricos sozialverträglicher Abstieg - Eine Hartz IV-Tragödie aus dem deutschen Osten. (unveröffenticht).